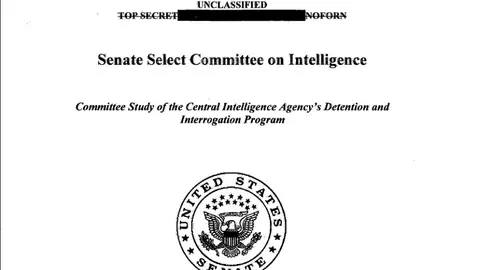Die unbemannte Drohne ist die bevorzugte Waffe des demokratischen Präsidenten Obama im sogenannten Krieg gegen den Terror – auch 13 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Unter Obama wurden bisher rund achtmal mehr Drohnen-Angriffe verübt als während George W. Bushs gesamter Amtszeit. Die Strategien des Pentagon und der CIA aber sind streng geheim, und so dürfen Journalisten nur die Trainingsbasis für Drohnenoperateure besuchen.
Sensenmann und Raubtier
Die US-Drohnen sind graue schlanke Vögel, die an Segelflugzeuge erinnern. Ihre Namen aber lassen keinen Zweifel offen: «Reaper» zu deutsch Sensenmann, kann vier «Hellfire» Raketen und zwei Bomben von je 220 Kilogramm abwerfen. Sein kleiner Bruder «Predator» (Raubtier) kann rund 14 Stunden lang in der Luft bleiben, drei Mal länger als ein bemanntes Kampfflugzeug. «Die Leistung von Reaper und Predator auf dem Schlachtfeld ist unbezahlbar», schwärmt Drohnenpilot Dennis.
Von Kampffliegern unterscheiden sich Drohnen durch eine riesige Kamera, die auf der Unterseite befestigt ist – und durch eine Satellitenschüssel im Cockpit. So werden die Bilder der Kamera vom überwachten Gebiet im Irak oder Pakistan zurück an die heimatliche Drohnenbasis übermittelt, wo ein Pilot und ein Kameramann vor Monitoren sitzen und die Raketen via Joystick auf das Ziel feuern.
Vom Jubel zur posttraumatischen Belastungsstörung
Nach zwei Jahren Dienst auf der US-Drohnenbasis mit Einsätzen im Irak und Afghanistan wurde Unteroffizierin Lynn wegen akuter Suizidgefahr entlassen. Am Anfang habe sie mit ihren Kollegen im Container noch gejubelt, wenn ein mutmasslicher Feind abgeschossen wurde. «Danach gingen wir feiern in die Bar, weil wir unsere Mission erfüllt hatten.» Wie eine Spannerin sei sie sich vorgekommen beim Überwachen von Zielpersonen aus der Luft. «Wir haben ihnen sogar beim Sex zugeschaut.»
Längerfristig mache dieser Job kaputt oder gefühllos. Tatsächlich zeigen Studien, dass Drohnen-Piloten gleich viele posttraumatische Belastungsstörungen erleiden wie Soldaten auf dem Kriegsfeld. Auf der Trainingsbasis widerspricht Hauptmann Sean der Kritik, dass der Drohnenkrieg ein feiger Krieg sei. «Wir haben uns verpflichtet, unserem Land zu dienen, und wir geben unser Bestes.» Seinen Nachnamen darf er auf Anweisung des Pentagon nicht nennen, offenbar hat man Angst vor Drohungen. Sean bekräftigt, stolz auf seinen Job zu sein: «Wir haben schon viele Leben gerettet.»
Aufs Kommando vertrauen beim Töten
Der für die USA saubere Krieg scheint aber längst nicht so präzise zu sein, wie das Präsident Obama in seinen Ansprachen jeweils betont. Recherche-Organisationen schätzen, dass rund 20% der Toten bei Drohnenangriffen in Pakistan und im Jemen Zivilisten sind.
Im Pentagon herrscht Stillschweigen darüber und auf der Holloman Base sagt Drohnenpilot Sean, er kenne diese Statistik nicht. Ebenso wenig wissen er und der Kameraoperateur über die Person, die sie tagelang überwachen und schliesslich töten. Haben sie keine Angst, dass die Zielperson gar kein Terrorist sein könnte? «Überhaupt nicht! Wir müssen den Informationen des Kommandos vertrauen».