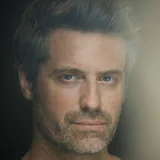Erschossen. Erschlagen. Da liegt er, der stinkreiche Chocolatier – mausetot zuhause. Verdächtige sind kaum an einer Hand abzuzählen. Ausgerechnet der Stricher mit dem ungarischen Akzent ist der einzige mit einem anständigen Alibi.
Klare Sache: Das ist ein Fall für das neue Zürcher «Tatort»-Duo, den die Drehbuchautoren Stefan Brunner und Lorenz Langenegger den beiden Ermittlerinnen eingebrockt haben. Nur so wenig steht zur Stunde fest: «Schoggiläbe» zeigt Zürich nicht von seiner Schokoladenseite.
Angebissen? Ein Skype-Gespräch über Kapitalismus und Klassenkampf, Klischees und Korsette und, na klar doch, Corona.
SRF: Eine knutschende Kommissarin im Club, Menschen ohne Mundschutz, Händeschütteln: Wie fremd ist Ihnen die präpandemische Welt schon geworden?
Stefan Brunner: Fremd. Während des ersten Lockdowns war es allerdings schlimmer. Damals war ich völlig irritiert, wenn ich in Filmen maskenlose Menschen in Restaurants sitzen sah, in denen die Tische nicht durch Wände getrennt waren.
Lorenz Langenegger: Ich habe mir «Schoggiläbe» gestern wieder angeschaut und kein einziges Mal «Corona» gedacht. Vermutlich nur, weil mir zu diesem «Tatort» die Distanz fehlt.
Zu Beginn der Pandemie dachte aber auch ich bei jeder Filmszene: «Achtung! Abstand! Auseinander!»
Ich hege den Verdacht: Eine «Tatort»-Folge, die im Zürcher Chocolatier-Milieu spielt, schreibt man, weil man sich endlich den Bubentraum verwirklichen will, eine Schokoladenfabrik von innen zu sehen?
LL: (lacht) Wir sind keine Location-Scouts, sondern Drehbuchautoren.
Die Herren sind sich wohl zu fein für Recherchen vor Ort?
LL: Recherche wird überschätzt. Im Zweifelsfall male ich mir lieber aus, was ich nicht kenne, und mache dann den Reality-Check.
SB: Schokolade hat etwas Sinnliches, auch im visuellen Sinne. Wir haben Szenen geschrieben, in denen Schokoladentafeln am Fliessband verpackt werden. War leider schwer umsetzbar.
Geld und Schokolade: War die Versuchung zu süss, sich an den Zürcher Kardinalklischees abzuarbeiten, die kein Verfallsdatum haben?
LL: Wenn man einen neuen Zürcher «Tatort» schreibt und versucht, ausgerechnet das auszuklammern, was die meisten Menschen mit Zürich verbinden, kommt es auch nicht gut.
SB: Die Grundthemen unserer ersten beiden «Tatort»-Folgen sind Kapitalismus und Klassenkampf. Das haben wir auch in den Figuren angelegt. Jetzt steigen wir auf den Zürichberg, um die Figuren besser auszuformulieren, die noch ein paar Geheimnisse haben.
Recherche wird überschätzt.
Die seelische Leere von Villenbesitzern, die Verstörung einer Erbin, die der vermögende Vater ins Internat abgeschoben hat, höchst verwickelte Verwandtschaftsverhältnisse: Wann wird ein Krimi-Konstrukt zum Korsett?
LL: Die grösste Gefahr ist, dass ein Film einen kalt lässt. Mein Anspruch ist es, dass das Publikum an allen Figuren andocken kann. Ihre Nöte, Verzweiflung und Freuden versteht.
SB: Überhöhung ist Programm des Zürcher «Tatort» und passt gut zu unserer Fabulierlust. Wir sitzen derzeit an den Folgen 7 und 8 und sind dabei, noch einen draufzusetzen.
Bloss nichts verraten.
SB: Mir macht in «Schoggiläbe» vor allem die Figur der grausamen Grossmutter viel Freude. Ein Fantasieprodukt! Wenn man den Hyperrealismus verlässt, erschliessen sich völlig neue Möglichkeiten.
Der etwas abgegriffene Satz: «Er konnte sich alles kaufen, nur das Wichtigste nicht», den ein ungarischer Stricher über das reiche Mordopfer äussert, hat sich nicht vermeiden lassen?
LL: Den kann uns ein böser Kritiker um die Ohren schlagen, weil er nicht erklärt haben will, was er schon verstanden hat. Aber auch so einen Satz erträgt es zwischendurch. «Tatort» ist Fernsehunterhaltung am Sonntagabend und kein Arthouse-Kino.
Aber dann doch Unterhaltung mit sozialkritischem Anspruch. «Schoggiläbe» entwirft ein Panorama des Prekären, das auch vor den Türen der Reichen nicht haltmacht.
LL: Die Einkommensschere geht immer weiter auseinander. Wir scheinen uns zurück in eine Art Feudalgesellschaft zu entwickeln, in der wenige ganz viel haben, aber auch viel arbeiten müssen. Sie brauchen also viel Personal, um den Alltag zu bewältigen. Es gibt neue Diener – den Essenslieferanten, das Kindermädchen, den Hundesitter.
Und Obdachlose. In einer Schlüsselszene erzählt Kommissarin Grandjean von einem Penner, dem sie eine Zwanzigernote zusteckte, «weil ja zehn Franken in Zürich nicht reichen für ein Frühstück.» Dann fragt Sie in die Kamera: «Was würden Sie tun?» Verraten Sie es uns.
SB: Manchmal gebe ich Geld, manchmal nicht. Seit Corona lebe ich fast bargeldlos.
LL: Vermutlich wäre es richtig, immer etwas zu geben. Das geht leider nicht. Ich habe das Dilemma so gelöst, dass ich «Stammkunden» habe, die ich kenne und denen ich immer etwas gebe.
Die Familie lässt einen nicht los.
Warum braucht es diesen berühmten Bruch mit der vierten Wand, der sich durch diese Folge zieht?
SB: Die Idee ist es, in jeder dieser Zürcher «Tatort»-Folge eine Meta-Ebene zu etablieren. In «Züri brännt» war es dieser Geist, der auftauchte. In «Schoggiläbe» äussern sich die Hauptfiguren zum Thema «Geld und Kapitalismus» – und zwar direkt in die Kamera.
Das macht ihre Anliegen dringlich. Und allzu deutlich?
LL: Das Motto von «Schoggiläbe» ist: Niemand entkommt sich selbst. Daraus ergab sich für uns das Bedürfnis, die Figuren etwas sagen zu lassen, was sie selbst ihren besten Freunden nicht anvertrauen würden. Das sind intime Momente, die sie nur mit dem Publikum teilen.
Was auch auffällt: In «Schoggiläbe» sind fast alle Figuren Gefangene ihrer eigenen Familienbanden. Wie haben Sie selbst diese Fussfesseln im Kopf abgestreift?
SB: Egal, ob man sich entfremdet oder nicht, die Familie lässt einen nicht los.
LL: Ich besuche meine Eltern gern und oft. Dafür sitze ich viele Stunden im Zug. Familie ist ein Spannungsfeld für alle.
Ermittlerin Tessa tritt einmal voller Wut den Rückspiegel eines am Strassenrand geparkten Autos weg. Kleine Handlungsanweisung für den Umgang mit der eigenen Herkunft?
LL: Soviel haben wir uns gar nicht gedacht beim Schreiben. Aber ich finde es grossartig, wenn die Zuschauer in Szenen mehr erkennen als das, was wir Autoren uns beim Schreiben überlegt haben.
Ein Film funktioniert dann am besten, wenn er über das hinausweist, was die Macher sich überlegt haben.
Das Gespräch führte Stefan Gubser.