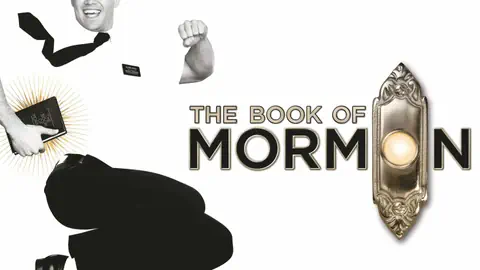Sie machen es den Satirikern aber auch einfach: Die Geschichte der Mormonen – auch Latterday Saints (LDS) genannt – ist so schräg, dass es nicht mehr viel Überspitzung braucht.
Ein armer Bauernjunge findet Anfang des 19. Jahrhunderts in den USA goldene Platten mit einer Art Fortsetzung der Bibel. Er übersetzt sie aus dem Altägyptischen mit Hilfe eines magischen Steines in seinem Hut.
Zwei naive Mormonen im trostlosen Afrika
Ein gefundenes Fressen für die Macher der Erfolgsserie «South Park» Trey Parker und Matt Stone und Bobby Lopez. Sie kreierten das Musical «Book of Mormon», das nach London, New York, Melbourne und Sydney nun erstmals im deutschsprachigen Raum zu sehen ist.
Das Musical erzählt die Geschichte zweier Mormonen, die ausgerechnet nach Uganda geschickt werden – in ein trostloses Dorf, gebeutelt von HIV, Kriegsfürsten und Armut.
Die Menschen sind hoffnungslos. Erst als einer der Missionare, der dickliche, schusselige Elder Cunningham, die Geschichte der Mormonen aufpeppt und auf die lokalen Verhältnisse anpasst, beginnen sich die Menschen zu interessieren. Mit dem Resultat, dass die Geschichte des «Book of Mormon» noch absurder wird.
Ein Beispiel: Die afrikanischen Dorfbewohner glauben, dass HIV geheilt wird, indem man Jungfrauen vergewaltigt. Und weil es keine Jungfrauen mehr gibt, vergewaltigen sie Kinder. Missionar Elder Cunningham behauptet nun, im «Book of Mormon» stehe, man dürfe keine Kinder vergewaltigen. Gegen HIV helfe Sex mit einem Frosch.
Humor mit Hochwasserhosen
Das zeigt: «Book of Mormon» ist bitterböse. Aber nicht nur. Das Musical ist kreativ und witzig. Die Liebesballade ist aufgeladen mit sexuellen Anspielungen, endet aber in der Taufe. Die Glaubenskrise des Strebers unter den Mormonen, Elder Price, wird als Trennungszene inszeniert.
Wenn eine junge Dorfbewohnerin vom Paradies träumt, reimt sich plötzlich Salt Like City auf «shitty». Eine Parodie auf das oft allzu süsse Genre Musical. Und auch handwerklich passt alles zusammen: Der Gesang hat Qualität, die Tanzschritte stimmen – und der dickliche Elder Cunningham mit seinen Hochwasserhosen sieht dabei immer etwas ungelenk aus.
Angst und erste Zweifel
Die Macher des Musicals machen sich lustig über die Naivität der Missionare, über die unterdrückte Homosexualität, über ihre Furcht vor der Hölle. Darunter aber liegt die Angst zu versagen, Fragen über den Erwartungsdruck der Eltern und die ersten Zweifel an der eigenen Überzeugung. Fragen, die uns alle ansprechen.
Im Musical wird die Religion zwar ständig aufs Korn genommen, doch am Ende gibt der Glaube den Dorfbewohnern Hoffnung und hilft ihnen, sich gegen die brutalen Kriegsfürsten zu erheben.
Auf der Welle reiten statt protestieren
Trotz dieses versöhnlichen Endes: Die Mormonen oder Latterday Saints (LDS) kommen nicht nur gut weg im Musical. Statt sich gegen die Aufführungen zu wehren, haben sie sich aber entschieden, die Öffentlichkeit zu nutzen.
«Die Latterday Saints haben eine sehr professionelle PR-Abteilung», erklärt Religionswissenschaftlerin und LDS-Spezialistin Marie-Theres Mäder. «Sie wissen, dass sie eine schwierige Aufgabe haben, ihr Narrativ mit ihrer teilweise rassistischen Geschichte, in der heutigen Zeit nach aussen zu vertreten.»
Also nutzen die LDS das Interesse, das durch das Musical geweckt wird, und schalten Werbung in den Programmheften, in den U-Bahnen oder stehen – auch in Zürich – nach der Vorstellung vor den Türen des Musicaltheaters. Anständig gekleidet, mit ihrem «Book of Mormon» im Gepäck, verbreiten sie ihre Version der Geschichte.