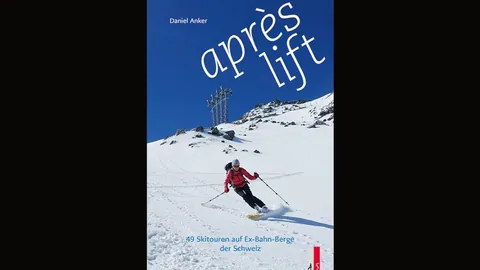Was andere als Schandflecken in der Landschaft bezeichnen, sind für ihn die Objekte der Begierde. Jedes Wochenende reist Oliver Gutfleisch durch die Schweiz, auf der Suche nach verlassenen und nicht mehr genutzten Gebäuden. Diese fotografiert er – der Ästhetik wegen, aber auch wegen der Geschichten und für die Nachwelt.
Radio SRF 1: Warum fotografieren Sie diese verlassenen Orte?
Oliver Gutfleisch: Es ist, als ob man in einer Zeitkapsel in die Vergangenheit reist. Zum Teil sind die Gebäude seit Jahrzehnten in quasi unverändertem Zustand. Die Betten stehen noch dort. An den Wänden hängen noch Bilder. Zeitungen liegen herum. Auf dem Nachttisch stehen vielleicht noch Medikamente. Das alles gibt Aufschluss über die Menschen, die einst hier lebten.
Es ist, als ob man in einer Zeitkapsel 70 Jahre zurückreist.
Das ist die Faszination. Wenn es mir dann noch gelingt diesen Ort fotografisch schön festzuhalten, dann ist das ein zusätzlicher «Wow-Effekt». Diese Bilder lösen wiederum Emotionen aus. Es gab schon Hausbesitzer, die beim Anblick der Fotografien weinen mussten. Was will man noch mehr. Viele Dinge gehen je länger je mehr verloren. Ich erhalte einen Teil für die Nachwelt.
«Lost Places» in der Schweiz
-
Bild 1 von 10. Das Bett ist noch gemacht. Das «Heimetli» ist seit ca. 40 Jahren unbewohnt. Eine zwölfköpfige Familie lebte einst hier. Im Küchenschrank lag noch eine Teeverpackung aus dem Jahre 1979. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 2 von 10. Faszination «Urzustand». In der oberen Etage dieses Wohn- und Bauernhauses ist die Küche noch im «Urzustand» (ca. 1780). Das Haus wird bald fachgerecht saniert und bleibt erhalten. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 3 von 10. Die Bahn ohne Seil. Die Talstation einer Luftseilbahn, die seit den 90er-Jahren ausser Betrieb ist. Die Tragseile wurden aus Sicherheitsgründen abmontiert – der Rest steht noch. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 4 von 10. Das «Heimetli» des alten Mannes. Am Anfang kam der alte Mann noch ab und zu aus dem Altersheim nach Hause in sein «Heimetli» (Baujahr ca. 1853). Das ist inzwischen 20 Jahre her. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 5 von 10. Das Haus der «Katzentrudi». Hier lebte zuletzt eine Frau und mit ihr angeblich rund 50 Katzen. Laut Aussagen von Landwirten in der Umgebung wurde die eine oder andere auch mal verzehrt. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 6 von 10. Die alte Mosterei. Seit der Betrieb in den 60er Jahren eingestellt wurde, wird hier kein Saft mehr produziert. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 7 von 10. Der Starkalender und die «Füllis». Gefunden im «Haus des Weinhändlers». Zur Zeit als Schauspieler Rock Hudson das Cover zierte, schrieb man noch mit Füllfederhaltern. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 8 von 10. Wer fuhr wohl mit diesem Mofa? In einem Hochstudhaus (Baujahr 1770) stehen alte Mofas. Das Haus wurde in der Zwischenzeit abgerissen. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 9 von 10. Festgehalten für die Nachwelt. Diese Stube und das gesamte «Heimetli» aus dem Jahre 1796 wurden inzwischen geräumt und saniert. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
-
Bild 10 von 10. Einst Dorfdörrerei und Ledergerberei. Später ein Stauraum. Dann in Vergessenheit geraten. Bildquelle: Oliver Gutfleisch.
Je älter desto besser?
Grundsätzlich ja. Je älter und je mehr im «Urzustand» ein Objekt ist, desto interessanter wird es. Schlussendlich geht es um die Geschichten. Erst durch diese erhält eine Fotografie ihren Wert, egal was man fotografiert. Je mehr man weiss, desto faszinierender wird es. Bei jedem Objekt versuche ich nebst dem Baujahr auch etwas über die Geschichte und die letzten Bewohner zu erfahren.
Die Schweiz ist ein aufgeräumtes Land. Gibt es hier überhaupt verlassene Orte?
Man glaubt es gar nicht, aber die gibt es. Gebäude, die seit Jahrzehnten verlassen sind, gibt es in der Schweiz natürlich nicht wie Sand am Meer. Man muss sie suchen und braucht etwas Glück.
Und wie finden Sie die?
Google Maps und Google Earth sind sehr hilfreich, damit klappere ich ganze Gebiete ab. Zum Teil erkennt man gar eingestürzte Dächer. Ich lasse meine Fantasie walten, suche im Internet nach Begriffen wie «Schandfleck» oder «verlottertes Haus». Vieles entdecken meine Kollegin und ich auch unterwegs. Dann sprechen wir die Nachbarn an, ob das Gebäude tatsächlich unbewohnt ist und erkunden uns nach den Besitzerinnen.
Hinterlasse nichts als deine Fussspuren und nimm nichts mit, ausser deine Fotografien.
Wie viele verlassene Orte haben sie schon erkundet?
Ziemlich genau 460. Ich dokumentiere alles akribisch: Den Zeitpunkt des Besuchs, das Baujahr, den Zustand, die Objektart und auch die Koordinaten.
Aber die Koordinaten, die sind geheim?
Es ist einer der Grundsätze, an die ich mich halte. Das Publikmachen eines Standorts ist das Dümmste, das man machen kann. Auch poste ich in den sozialen Medien keine Aussenaufnahmen oder nur, wenn das Objekt bereits abgerissen wurde. Sonst gibt es am Wochenende einen Aufmarsch an Schaulustigen.
Innerhalb weniger Wochen kann ein verlassener Ort zerstört sein. Denn leider halten sich nicht alle an unseren Kodex, der lautet: «Hinterlasse nichts als deine Fussspuren und nimm nichts mit, ausser deinen Fotografien.»
Bücher, Blogs, soziale Medien: «Lost Places» sind beliebte Motive und scheinen immer mehr Menschen in den Bann zu ziehen. Wie schätzen Sie das ein?
Grundsätzlich ist es schön. Ich bin auch auf diesen Zug aufgesprungen. Aber es gibt eine gewisse Übersättigung. Einige Objekte sind leider nicht mehr «lost», sondern heruntergewirtschaftet, totgesprayt, ja kaputt gemacht. Es gibt Foren, da werden einem alle Informationen zu einem Objekt auf dem Silbertablett präsentiert. Damit habe ich Mühe.
Gewisse Objekte kann man mittlerweile gegen Eintritt offiziell besuchen, zum Beispiel das ehemalige Grandhotel Locarno oder ehemalige Heilstätten bei Berlin.
Das finde ich prinzipiell nicht schlecht. Dann ist es legal und kontrolliert. Gerade für Einsteigerinnen, die Lust haben, mal einen verlassenen Ort zu fotografieren, ist das eine gute Möglichkeit.
Verlassene Skilifte
Auch in den Schweizer Bergen findet man so manche verlassenen Orte. Buchautor und Skitourenexperte Daniel Anker ist auf 49 Berge gestiegen, auf die einst ein Lift fuhr. Nicht wenige Anlagen stehen noch heute auf dem Berg.
Beispiele für ehemalige Skigebiete «Lost Ski Area Projects»
-
Bild 1 von 6. Cima di Furggen / Zermatt. Der höchstgelegene «Lost Place» der Schweiz. Die Bergstation auf dem Cima di Furggen (3491m). Einst wollte man von hier eine Verbindung aufs Matterhorn bauen. Von 1952 – 1993 war die Bahn in Betrieb. Das Seil riss. Repariert wurde es nicht mehr. Bildquelle: Daniel Anker / Après-Lift.
-
Bild 2 von 6. Moléson-sur-Gruyères. Ein Skilift-Relikt in der Landschaft: Die Talstation des Téléski Les Reybes – Le Poyet. In Betrieb war er von 1963 bis circa 2000. Bildquelle: Daniel Anker / Après-Lift.
-
Bild 3 von 6. San Bernardino. Der Sessellift scheint noch immer bereit zu sein. Doch seit 2013 befördert er keine Skifahrerinnen mehr auf den Gipfel. Wie es mit dem 1971 eröffneten Skigebiet weitergeht ist offiziell noch unklar. Bildquelle: Daniel Anker / Après-Lift.
-
Bild 4 von 6. Super Saint-Bernard. Abgehängte Gondeln auf dem Col de Menouve. Das Skigebiet Super Saint-Bernard war von 1962 – 2010 in Betrieb. Auch zehn Jahre danach stehen die Gondeln noch da. Bildquelle: Daniel Anker / Après-Lift.
-
Bild 5 von 6. Château-d'Oex. Die zwei Personen warten vergebens auf einen Bügel respektive ein «Tellerli». Von 1970 – 2017 wurde hier Lift gefahren. Bildquelle: Daniel Anker / Après-Lift.
-
Bild 6 von 6. Haut du Mollendruz. Die Liftanlage ist weg. Die Inschrift auf dem Sockel erinnert an belebtere Zeiten. Von 1970 bis circa 1996 war hier im Jura ein Skilift in Betrieb. Bildquelle: Daniel Anker / Après-Lift.
Das Gespräch führte Fabio Flepp.