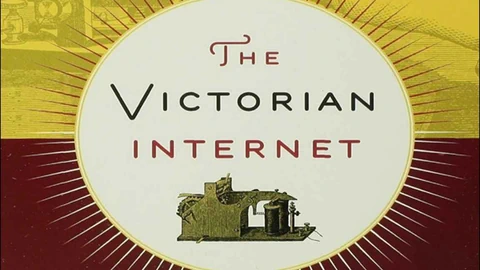-
Bild 1 von 19. Die Cable Landing Station eine halbe Stunde südlich von Naha, Okinawa. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 2 von 19. Eingezäunt, aber menschenleer – das Kabel wird von Tokyo aus überwacht. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 3 von 19. Ja, ich bin richtig hier. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 4 von 19. Diese Tsunami-Warntafeln zeigen Höhe über Meerespiegel an. Bis 5 m ist die Tafel rot, bei 6-19 m gelb, ab 20 m blau. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 5 von 19. Station Manager Tsukasa Tanaka (rechts) und Assistant Manager Masayuki Nakashima zeigen mir die Station. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 6 von 19. Der «Dining Room» wird nicht mehr gebraucht. In den 70ern arbeiteten hier 50 Personen, heute ist die Station unbemannt. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 7 von 19. Nakashima-san zeigt auf einem Satelliten-Bild, wo das Kabel die Station verlässt. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 8 von 19. Kabelkanäle im Satellitenbild. Stern: Landing Station; 1. analoges Kupfer 2. auch nicht mehr in Betrieb 3. SEA-ME-WE-3. Bildquelle: Google/SRF.
-
Bild 9 von 19. Kabel im Querschnitt: Kunststoff (Schutz), Kupfer (Strom), Stahl (Schutz), Glasfasern, Spezialdraht (Zugentlastung). Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 10 von 19. Den zugelieferten Starkstrom in 220 V Wechselstrom und 48 V Gleichstrom transformieren. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 11 von 19. Bei Stromausfall überbrücken diese Batterien eine Stunde lang. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 12 von 19. Gasturbinen-Generator, 750 KVA Leistung. Versorgt mit 20'000 Litern gelagertem Treibstoff die Station 50 Stunden lang. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 13 von 19. Herr Nakashima öffnet die Türe zum Raum, wo das Kabel ankommt. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 14 von 19. Durch diesen Schacht gelangen die Kabel in die Station. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 15 von 19. MOC, JIH und SMW-3 (oder SEA-ME-WE 3 bzw. South-East Asia - Middle East - Western Europe); und mein Zeigefinger. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 16 von 19. Vom Dach der Station Blick auf den Strand bei Ebbe. Rechts über dem Kandelaber ist der Beton-Schacht des SEA-ME-WE 3. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 17 von 19. Die Treppe von der Station zum Strand hinunter. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 18 von 19. Hier sinkt der Kabelschacht ins Meer ab. Einige zehntausend Kilometer weiter westlich: Europa. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
-
Bild 19 von 19. Das Selfie mit dem Kabel. Bildquelle: Guido Berger/SRF.
Der ältere Portier ist verwirrt. Er kann kein Englisch, ich kein Japanisch. Ich bin in einem schmucklosen Bürogebäude im Zentrum von Naha, der grössten Stadt auf Okinawa. Hier ist eine Zweigstelle von KDDI, dem Betreiber des «SEA-ME-WE 3»-Kabels. Ich will herausfinden, wo dieses Kabel genau anlandet und ob ich die «Landing Station» besuchen kann.
Unterseekabel faszinieren mich, seit ich 1996 den grossartigen Aufsatz «Mother Earth Mother Board» von Neal Stephenson verschlungen habe. Wenn ich mich auf einen Grund festlegen müsste, Technologie-Journalist werden zu wollen, dann ist es dieser Aufsatz. Weil er der abstrakten Idee «Internet» eine physische Form verleiht, sie geografisch platziert. Information ist nicht körperlos: Die Glasfaserkabel sind die Adern, durch die sie fliesst.
Seither lese und berichte ich über die Kabel. Und wenn ich kann, besichtige ich eins.
Das weiss der Portier nicht. Er versucht in Panik, im Erdgeschoss jemanden aufzutreiben, der Englisch spricht – erfolglos. Nach einer Weile kann ich ihn überzeugen, mich zum KDDI-Büro im sechsten Stock zu begleiten. Dort klopft er an eine gesicherte Stahltür und übergibt mich einem gross gewachsenen, feschen Herrn im leichten rosa Sommerhemd, gesunde Bräune, ohne Krawatte.
Reportagen und Gespräche zum Unterseekabel in Okinawa
Hinter ihm im Raum sehe ich zwei Tischreihen mit PCs. Alles etwas schäbig, unaufgeräumt und auch für japanische Verhältnisse eng. Im Gang lärmt die Klimaanlage, draussen ist es schwül.
Der Mann im rosa Hemd kann Englisch, weiss aber nicht so recht, was er mit mir anfangen soll. Ich erzähle, dass mich Unterseekabel faszinieren. Ich zeige meinen SRF-Badge. Ich vergleiche uns mit der japanischen Rundfunkgesellschaft NHK. Das Stichwort «Television» scheint mir etwas Relevanz zu verleihen, ich bin nun mehr als ein verirrter Tourist. Er verweist mich an die Zentrale in Tokyo.
Im Hotel telefoniere ich mit Maki Sato, der Mediensprecherin von KDDI in Tokyo. Nach einem längeren E-Mail-Verkehr erhalte ich schliesslich die Zusage: Am letzten Tag vor meiner Abreise kann ich das Kabel besichtigen gehen.
39'000 Kilometer
Das «SEA-ME-WE 3»-Kabel verbindet Europa mit Asien. Wenn ich ein E-Mail nach Europa schicke, saust es nach Taiwan, durch das südchinesische Meer, um Malaysia herum in den Indischen Ozean, durch das Rote Meer und den Suez-Kanal, durch das Mittelmeer, um die Iberische Halbinsel in den Atlantik, durch den Ärmelkanal und kommt schliesslich nach einigen hundert Millisekunden in Deutschland aus dem Meer. Das Kabelsystem ist 39'000 Kilometer lang und das längste der Welt, weil in Indonesien ein Arm noch Australien anschliesst.
Karte: Die Landing Stations des SEA-ME-WE-3-Kabels
Auf Okinawa ist die letzte, östlichste der 39 «Landing Stations». Eine «Landing Station» ist das Gebäude an der Küste, in dem das Kabel anlandet. Von wo aus das Kabel mit Strom versorgt wird, wo der Netzwerkverkehr weitergeleitet wird. Hier kommt das Internet aus dem Meer. Ich bin zwar in den Ferien hier, aber wenn ich schon hier bin, muss ich dieses Kabel sehen.
Okinawa in der Ryūkyū-Inselgruppe liegt auf halbem Weg zwischen Japan und Taiwan. Bevor Okinawa zu Beginn des 17. Jahrhunderts von Japan erobert wurde, war das Ryūkyū-Königreich unabhängig. Und profitierte von der günstigen Lage an der Handelsroute zwischen Japan, Taiwan und dem chinesischen Festland.
In erstaunlicher historischer Kontinuität verläuft das Kabel also auf der gleichen Route, wo früher auf Handelsschiffen Information transportiert wurde. Damals als Paket oder Brief oder im Kopf der Reisenden. Heute ist die Information zwar in Lichtimpulsen digitalisiert und ein bisschen schneller, aber sie nimmt noch immer den gleichen Weg.
Die alte Station
Die «Landing Station» liegt ausserhalb des kleinen Fischerdörfchens Minatogawa, etwa eine halbe Autostunde südlich von Naha. Ich habe die genaue Adresse von Mediensprecherin Sato erhalten; das Navigationsgerät des Mietwagens leitet mich hin.
Ich bin eine Stunde zu früh da. Das Gebäude liegt naturgemäss direkt am Meer, in einem Wohnquartier. Es ist gross und weiss gestrichen, von einem Zaun mit Stacheldraht umgeben. Ich steige aus und streune um das Gebäude herum, mache Fotos. Nach wenigen Metern im Gebüsch sind meine Hosen voller Kletten. Dass die giftigen Habu-Schlangen genau in solchen Büschen leben, wird mir erst auf dem Heimweg einfallen.
Als ich verschwitzt und mit dreckigen Hosen aus dem Gebüsch stolpere, winkt mir Herr Nakashima vom Gelände aus zu. Nicht der professionellste Auftritt meinerseits. Nakashima-san übersieht das höflich.
Die «Landing Station» ist gut 3000 Quadratmeter gross und menschenleer. Sie steht schon seit 1975, damals landeten hier noch analoge Kupferkabel an. Fünfzig Personen arbeiteten hier. Heute ist die Station unbemannt, der «Dining Room» ist unbenutzt. Die Überwachung erfolgt in der Zentrale in Tokyo. Hier kommt nur ab und zu jemand vorbei für Routinechecks und Wartung.
Masayuki Nakashima und sein Chef, Station Manager Tsukasa Tanaka, sind aus der KDDI-Zweigstelle in Naha gekommen und führen mich durch das Gebäude. Wir tragen Plastikpantoffeln und schlurfen durch spiegelglatt gebohnerte Gänge.
Verlegen
In einem kleinen Schauraum zeigt mir Herr Nakashima das Modell eines Kabelschiffs. Unterseekabel zu verlegen, ist eine alte Kommunikationstechnologie: Kaum war das Gummi Guttapercha gefunden, kam man auf die Idee, ein Telegrafen-Kabel aus Kupfer damit zu isolieren und von England nach Amerika zu ziehen.
Im Prinzip ist das Verlegen eines Unterseekabels nicht kompliziert: Lade ganz viel Kabel auf ein Schiff; fahre mit dem Schiff quer übers Meer; lasse das Kabel ins Wasser.
Doch nun halte deinen Daumen hoch: So dünn ist dieses Kabel. Es liegt in 3'000 Metern Tiefe einfach so auf dem Boden des Indischen Ozeans. Aussen ist weisser, salzwasserbeständiger Kunststoff. Dann zwei Ringe Kupfer, für die Stromversorgung der Repeater, die das Signal alle 50 bis 80 Kilometer verstärken. Im Kern ein hochfester Spezialdraht, der verhindert, dass auf die Glasfasern Zugkräfte einwirken. Und eben die Glasfasern selbst – so dünn, dass wir einen Knopf damit annähen könnten. Diese Fäserchen übermitteln ein knappes Terabit pro Sekunde.
Um das Internet von einem Kontinent auf den anderen zu bringen, kann ein Kabelschiff heute genug Kabel an Bord nehmen, um den ganzen Ozean in einer Fahrt zu überqueren. Geht das Kabel bei einem kleineren Schiff dennoch aus, macht man das Ende an einer Boje fest und geht Nachschub holen.
Das Kabel darf nicht auf Felsen aufliegen oder frei schweben, auch ist es nicht beliebig biegbar. Deshalb muss mit Sonar und Unterwasser-Robotern eine ideale Route gefunden werden. Beim Verlegen muss das Schiff präzise so fahren, dass Geschwindigkeit und Kurs, Absinken des Kabels und die Strömungen in möglicherweise tausenden Metern Wassertiefe zusammen das Kabel genau an den richtigen Ort bringen.
Je näher das Kabel ans Ufer kommt, desto besser muss man es schützen. In erster Linie vor Schleppnetzen oder Ankern. Auch Erdbeben können Kabel beschädigen. Ab und zu beisst gar ein Haifisch hinein.
Auf den Kontinentalschelfen ummantelt man das Kabel deshalb mit Stahldraht, bis es etwa armdick ist. Oder verlegt es gleich in den Boden, mit einer Art Pflug. Der wird hinter dem Schiff hergezogen, gräbt eine Furche in den Grund, legt das Kabel hinein und deckt es gleich wieder zu. Noch näher am Ufer verlegt man es dann in Stahlröhren oder Kabelschächte aus Beton.
Reparieren
Herr Nakashima, Herr Tanaka und ich steigen auf das Dach der Station. Wir blicken auf den Strand. Es ist Ebbe. Im unregelmässigen Fels zwischen Muscheln und Algen sind mehrere Kabelschächte gut sichtbar. Nach Südosten ein schon sehr verwitterter Betonstreifen, der die alten Kupferkabel aus den 70er-Jahren enthält. Rechts davon ein Glasfaser-Schacht, der ebenfalls nicht mehr in Betrieb ist. Und Richtung Süden der Kanal, in dem «SEA-ME-WE 3» seit Dezember 1999 liegt.
Hinter dem Horizont liegt Taiwan. Ende 2006 beschädigte dort ein Erdbeben gleich mehrere Kabel. Internet-Verbindungen in ganz Süd-Ost-Asien waren tagelang schlecht oder ganz unterbrochen.
In einem solchen Fall wird zunächst Kapazität auf andere, noch intakte Kabel umgeleitet. Dann fährt ein Reparaturschiff los und angelt das defekte Kabel hoch. Dank den Repeatern und Messungen weiss man recht präzise, wo es unterbrochen ist. Eine Schlaufe frisches Kabel überbrückt die schadhafte Stelle. Bei schwerer See oder Überlastung der Reparaturschiffe kann das Wochen dauern.
Milliarden
Ein Kabel zu verlegen, ist teuer: Eines der ersten Kabel durch den Atlantik kostete fast zwei Milliarden Dollar. Heute sind die Kosten eher in der Grössenordnung einiger hundert Millionen.
Betrieben wird ein Kabel in der Regel von einem internationalen Konsortium, das die Nutzung der Bandbreite dann vermietet. Weil «SEA-ME-WE 3» ausserordentlich lang ist, sind 92 Telekom-Unternehmen daran beteiligt.
Der Hunger nach mehr Bandbreite ist weiterhin ungebrochen: Letztes Jahr schätzte ein in der Branche tätiges Beratungsunternehmen, dass mindestens zwei Milliarden Dollar jährlich in neue Kabel investiert werden. In den letzten Jahren floss viel davon in noch nicht gut erschlossene Regionen wie Brasilien oder Afrika südlich der Sahara. Ausserdem werden bestehende Kabelsysteme mit neuer Übertragungstechnologie aufgebessert. Heute aktive Unterwasserkabel gibt es nicht ganz 300.
Strom
Wir steigen wieder vom Dach. Herr Nakashima zeigt mir die Stromversorgung der Station. Von zwei verschiedenen kommerziellen Anbietern erhält die Station Starkstrom geliefert, der hier in einer grossen Halle transformiert wird. In gewöhnlichen 220-Volt-Wechselstrom für die Geräte im Schaltraum, die den Netzwerkverkehr abwickeln. Und in 48-Volt-Gleichstrom für die Stromversorgung des Kabels: die Verstärker und Repeater, die verhindern, dass das Signal über die Distanz «zu leise» wird.
Zwei, drei Mal im Jahr falle der Strom aus, erzählt Herr Nakashima. Dann wechselt die Station auf Batterie-Betrieb. In einem Raum stehen unzählige Batterien auf Gestellen. Sie können die Station für eine Stunde mit Strom versorgen. Bis dann muss der Generator laufen. Herr Nakashima öffnet eine Luke in einem grossen, eisblauen Kasten und sagt, das Triebwerk sei ähnlich wie das eines Jets. Im Gebäude ist genug Treibstoff gelagert, um den Jet fünfzig Stunden fliegen zu lassen.
Die Kathedrale
Dann ist es soweit. Wir betreten eine Kathedrale: den Raum, in dem das Kabel ankommt. Wie dünn, wie verletzlich es ist! Und doch fliegt hier alles, alles durch: die automatisierte Aktien-Transaktion; der Chat von frisch Verliebten; die neue Folge «Game of Thrones»; die Ferienfotos der Freundin; die Einladung zur Sitzung; die Meldung, dass die Spielfigur einen Level aufgestiegen ist; das Telefonat mit der Tante; meine Suche nach «Habu-Schlangen» in der Wikipedia.
Mich überkommt Ehrfurcht.
Das Kabel taucht aus einem rechteckigen Schlitz im Boden auf. Es ist nicht allein: Neben dem «SEA-ME-WE 3»-Kabel liegen das «Miyazaki – Okinawa Cable System (MOC)» und der «Japan Information Highway (JIH)». Das sind die beiden Kabelsysteme, die hier auf Okinawa die Hauptinsel Japans mit dem Kabel aus Europa verbinden.
Hier wird das Kabel «terminiert», also die Stromleitung und die Glasfasern getrennt. Deren Signal landet in mehreren Gestellen voller Netzwerkkomponenten, die ich nicht fotografieren darf. Es wird an Leitungen an Land weitergegeben oder wieder in eines der Unterseekabel in Richtung Japan geschickt.
Am Strand
Ich löchere Herrn Nakashima noch eine Weile mit technischen Fragen. Dann verabschieden wir uns. Ich verlasse das Gelände der Station und steige eine Betontreppe zum Strand hinunter.
Es ist bewölkt, aber angenehm warm. Es windet, das Meer rauscht etwas verschlafen.
Ich gehe vorsichtig über den sehr glitschigen Kabelkanal aus Beton. Ich folge ihm, bis ich den Punkt erreiche, wo er in den sanften Wellen versinkt.
Ich habe extra ein T-Shirt mit der Aufschrift «INTERNET» angezogen. Ich mache ein Selfie von mir und dem Kabel. Ich poste es auf Facebook.
Fast wünsche ich mir, ein leichtes Kribbeln in den Füssen zu spüren, als das Selfie unter mir hindurch gen Europa rauscht und wenig später das erste «Like» zurückkommt.