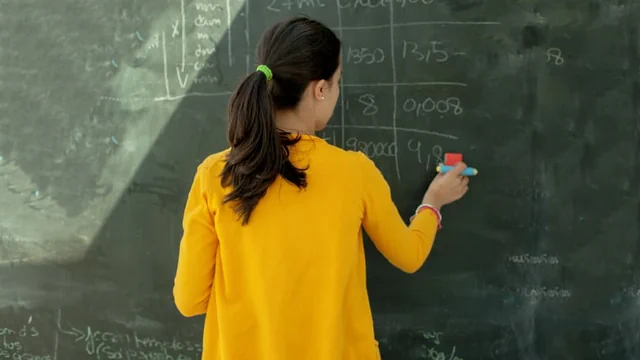Claudia* ist Juristin. Ihre Eltern waren Arbeiter. Der Vater Elektroinstallateur, die Mutter Masseurin.
Claudia war die erste ihrer Familie am Gymnasium und hat die Vorbehalte gewisser Lehrer gespürt: «Mir wurde das Gefühl vermittelt, dass ich besser etwas anderes machen sollte. Dass ich nicht so richtig ans Gymi passe.»
Die Eltern ihrer Klassenkameradinnen und -kameraden waren praktisch durchs Band Akademikerinnen und Akademiker.
Die Sprache der Statistik
Claudias Erfahrung spiegelt sich auch in der Statistik. Margrit Stamm ist emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften. Die Frage des Bildungsaufstieges ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte.
Gymnasium und Uni sind noch immer ein Privileg für jene Schichten, die schon gut gebildet sind.
Etwas pointiert ausgedrückt könne man sagen, dass Bildung in der Schweiz vererbt werde. «Gymnasium und Uni sind noch immer ein Privileg für jene Schichten, die schon gut gebildet sind», sagt Margrit Stamm.
In Zahlen ausgedrückt: Kinder von Akademikerinnen und Akademikern schaffen es mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent ans Gymi. Bei Kindern aus benachteiligten Verhältnissen sind es nur 24 Prozent – wohlgemerkt bei gleichen Leistungen und gleichem intellektuellem Potential.
Es ist eine Schieflage wie auf der Titanic – und sie hat sich seit Jahrzehnten kaum gebessert.
Strenger benotet, schlechter eingeschätzt
Woran liegt das? Die Gründe seien sowohl in der Schule, als auch in den Familien zu finden, so Stamm. «Aus internationalen Studien wissen wir, dass Kinder aus benachteiligen Verhältnissen von Lehrpersonen strenger benotet werden, als Kinder aus Akademikerhaushalten.» Arbeiterinnenkinder müssen also mehr leisten, um es ans Gymi zu schaffen.
Laut Margrit Stamm ist das aber noch nicht alles: «Lehrpersonen haben bei Arbeiterkindern tiefere Bildungserwartungen. Sie trauen ihnen weniger zu. Das zeigt sich dann bei sogenannten ‹Übertrittsentscheiden.›» Also der Entscheidung, auf welche weiterführende Schule ein Kind nach der Primarschule gehen soll.
Keine Empfehlung vom Klassenlehrer
Diese Erfahrung machte auch Lumi*, die heute selbst Gymnasiallehrerin ist. Als es darum ging, von der Primarschule in die Sekundarstufe zu wechseln, hätte sie den Notenschnitt für das Mittlere Niveau zwar gehabt. Für den Übertritt braucht es neben dem Schnitt aber auch die Empfehlung des Klassenlehrers – und die bekam Lumi nicht.
«Mein Vater hat versucht, sich zu wehren. Der Lehrer hörte ihm aber nicht zu. Er hatte wohl das Gefühl, Kinder mit Migrationshintergrund gehören in die Realschule. Mein Vater arbeitete damals in einer Fabrik. Vielleicht hätte der Lehrer meinen Vater ernster genommen, wäre er Arzt gewesen», erzählt Lumi.
Herkunft als Hürde
Lumis Vater war die Bildung seiner Tochter sehr wichtig, in Sarajevo hatte er Naturwissenschaften studiert. «Mein Lehrer ging aber trotzdem davon aus, dass ich zu Hause keine Unterstützung habe – oder dass wir ‹bildungsfern› sind.»
Auch Margrit Stamm sagt, dass die Familie eine grosse Rolle bei solchen Übertrittsgesprächen spielt. Für Akademikerinneneltern sei meist klar, dass ihre Kinder ans Gymnasium gehören. So scheuen sie auch keinen zusätzlichen Aufwand.
Bei Übertrittsentscheiden werfen sie ihren ganzen sozialen Status in die Waagschale, gar ihre finanziellen Mittel. Stichwort: Rekurse.
Weniger Geld, weniger Nachhilfe
Tatsächlich sei die Finanzkraft ein wichtiger Faktor. «Heute können sich vor allem gut situierte Familien für ihre Kinder private Nachhilfe leisten. Finanziell schlechter gestellte Familien können das schlicht nicht bezahlen. So fällen sie andere Bildungsentscheide für ihre Kinder. Ermutigen sie eher eine Lehre zu machen, damit sie schneller finanziell unabhängig werden», erklärt Stamm.
Viele Akademikerhaushalte würden ausserdem zeitig in die Frühförderung investieren. «Schon beim Eintritt in den Kindergarten gibt es grosse Unterschiede bei den Kindern.»
Nach den Ufzgi Zeitungen austragen
Claudia und Lumi wissen, was es heisst, mit knappen finanziellen Mitteln aufzuwachsen. «Meine Klassenkameradinnen und -kameraden gingen weit weg in die Ferien, trugen Markenkleider und wohnten in grosszügigen Häusern oder Villen. Wir in einer kleinen Dreizimmerwohnung.»
Bereits während der Sekundarschule begann Claudia zu arbeiten. Sie trug Zeitungen aus, um ein bisschen Geld dazuzuverdienen. Lumi arbeitete neben der Schule bei McDonalds.
Vielleicht hätte der Lehrer meinen Vater ernster genommen, wäre er Arzt gewesen.
Der Bildungsweg hängt in der Schweiz deutlich von sozio-ökonomischen Faktoren ab. Dies hat sich seit Jahrzehnten kaum verändert.
Gleichzeitig gilt das Schweizer Schulsystem aber als durchlässig – gerade dank dem dualen Bildungsweg: Nach einer Lehre können Lehrlinge via Berufsmatur an einer Fachhochschule studieren.
Das sei in punkto Bildungsgerechtigkeit eine Errungenschaft, meint Bildungsforscherin Margrit Stamm.
Probleme im Selektionssystem nicht beschönigen
Der Weg über die Berufsmatur dürfe allerdings nicht als Entschuldigung benutzt werden, um Kinder aus Arbeiterfamilien, die eigentlich ans Gymnasium könnten, auf später zu vertrösten.
Margrit Stamm plädiert dafür, die Talente der Kinder wahrzunehmen: «Die Probleme, die es im Selektionssystem im Hinblick aufs Gymnasium gibt, sind bekannt. Wir können sie nicht beschönigen.»
Man müsse schauen, dass Neigungen, Begabungen und Interessen ausschlaggebend sind, ob ein Kind ans Gymnasium komme oder eine Berufslehre beginnt. Und eben nicht die soziale Herkunft.
*Nachname der Redaktion bekannt.