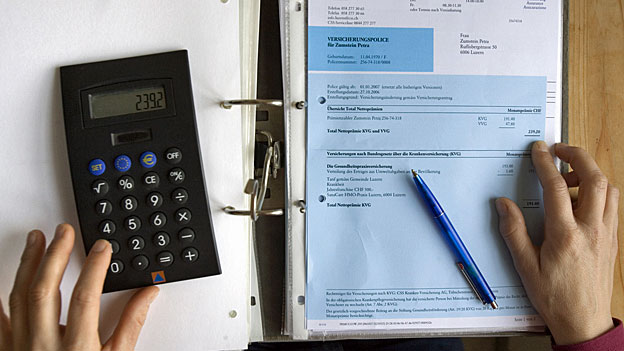Alljährlich neu stöhnt die Schweiz angesichts steigender Krankenkassenprämien. Ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht abzusehen. Auch 2016 erhöhen sich die Beiträge um durchschnittlich vier Prozent.
Der konsequente Kurs nach oben spiegelt sich auch in den individuellen Prämienverbilligungen (IPV). Die «sozialen Korrektive» – wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Vergünstigungen nennt – stehen all jenen Menschen zu, deren steuerbares Einkommen einen bestimmten Wert unterschreitet.
Wie hoch dieser ausfällt, variiert je nach Kanton. In Zürich etwa kann derjenige IPV beantragen, dessen steuerbares Einkommen höchstens 42'900 Franken beträgt. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist das entsprechende Anrecht bereits mit einem steuerbaren Einkommen von mehr als 35'000 Franken hinfällig.
Zunahme um 173 Prozent
In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich der landesweit ausgeschüttete Gesamtbetrag der IPV um satte 173 Prozent erhöht: von 1,467 Milliarden Franken im Jahr 1996 auf 4,007 Milliarden Franken im Jahr 2014.
Die Zahl der Menschen, welche vom Rabatt profitieren, ist im selben Zeitraum um 32 Prozent auf rund 2,2 Millionen gestiegen. Wie ist dieser Aufwärtstrend zu erkären? Wo führt er noch hin? Und was ist zu tun?
Dass hierzulande immer weniger Menschen aus eigener Kraft für die Krankenkassenprämien aufkommen können, hängt mit den Kostensteigerungen im Gesundheitswesen zusammen. Die Menschen werden immer älter, die Medikamente sind im weltweiten Vergleich zu teuer, und die Kantone betreiben nach wie vor zu viele Spitäler. Alle drei Faktoren lassen die Gesundheitskosten in die Höhe schnellen.
Scheidungen als Kostentreiber
Laut Felix Schneuwly, Gesundheitsexperte bei Comparis, gibt es indes noch andere Gründe, welche die Zunahme der IPV erklären. Zunächst hinken die Löhne den Krankenkassenprämien hinterher. Sie steigen zwar, aber nicht im selben Mass. Ferner wirkt unser Sozialleben als Treiber: «Aus jedem Haushalt mit Eltern, die sich trennen oder scheiden lassen, werden zwei Haushalte. Die Konsequenzen trägt oft der Staat in Form von IPV und Sozialhilfe.»
Ferner werden laut Schneuwly bei der Bemessung der Prämienvergünstigungen gewisse Entlastungen von Haushalten nicht oder zu wenig berücksichtigt. So seien die Ausgaben für Nahrungsmittel seit dem Zweiten Weltkrieg sukzessive zurückgegangen.
Die Kantone, welche die IPV-Ansprüche allein am steuerbaren Einkommen bemessen, müssten laut Schneuwly dementsprechend «auch den Warenkorb der Konsumgüter und Dienstleistungen betrachten» und die IPV senken.
Umverteilung kann nicht die Lösung sein
Die Zuwanderung, die oft ins Spiel gebracht wird, wenn die Kostenexplosion im Gesundheitwesen Thema ist, will Schneuwly als Faktor hingegen nicht gelten lassen. Dass der prozentuale Anteil der IPV-Bezüger seit 1996 konstant geblieben ist – er liegt nicht ganz bei einem Drittel aller Versicherten –, deutet er wie folgt: «Die Anzahl der IPV-Bezüger hat mit dem Bevölkerungswachstum Schritt gehalten. Es sind also nicht die Zuwanderer, welche den Sozialstaat überproportional belasten.»
Mit welchen Massnahmen sich die Schweiz aus dem Kosten-Dilemma befreien kann, ist eine politische Herausforderung. So will etwa die SP mit einer Volksinitiative die Krankenkassenprämien auf maximal 10 Prozent der Mittel jedes Haushalts beschränken. Hier ist Schneuwly allerdings skeptisch.
Wenn weitere Kreise von einer systematischen Umverteilung profitierten, fielen die Mechanismen weg, mit denen Kopfprämien und freie Kassenwahl auf die Kosten drücken. Dann könne passieren, was der IV widerfahren sei. Dort habe niemand die Ausgaben gebremst, bis die Politik gezwungen war, die Notbremse zu ziehen.