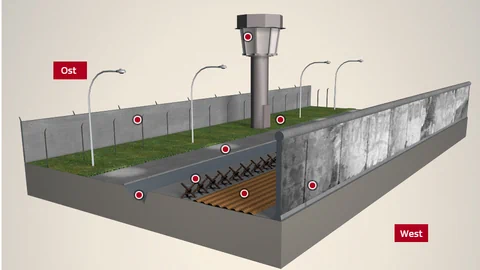-
Bild 1 von 6. Axel Hahn als Kindergartenkind im Jahr 1976. «Ich hatte eine schöne Kindheit», sagt der 41-Jährige heute. «Uns hat es an nichts gefehlt.». Bildquelle: Privat.
-
Bild 2 von 6. Lange Streifzüge durch die Natur, Ferienlager an der Ostsee: Axel Hahn bei der Einschulung im Jahr 1978. Bildquelle: Privat.
-
Bild 3 von 6. Reisepass der DDR: «Ich bin in der DDR aufgewachsen, der Staat und die Grenzen waren da, seit ich denken konnte.» . Bildquelle: Privat.
-
Bild 4 von 6. Das Visum in Axels Personalausweis für die «mehr-malige» Reise in den Westen, ausgestellt Mitte November 1989. «Ich glaube, ich ging vor allem, um mir das Begrüssungsgeld nicht entgehen zu lassen.». Bildquelle: Privat.
-
Bild 5 von 6. Die Aufforderung zur Musterung für die Nationale Volksarmee. In der DDR war der Wehrdienst Pflicht. 18 Monate waren üblich. Wer studieren wollte, ging länger. Bildquelle: Privat.
-
Bild 6 von 6. Axel Hahn. Bildquelle: Privat.
«Aufgewachsen bin ich in Strausberg, rund 30 Kilometer östlich von Berlin. Das ist eine wirklich schöne Gegend mit viel Wald und vielen Seen. Ich hatte dort eine sehr behütete Kindheit, an die ich viele schöne Erinnerungen habe – an lange Streifzüge durch die Natur oder an Ferienlager an der Ostsee. Mir ging es gut, wir hatten wirklich alles, was wir brauchten.
Mitte der achtziger Jahre sind wir von einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in eine Neubauwohnung gezogen. 75 Quadratmeter für 80 Mark Ost, solche Preise muss man sich mal heute vorstellen. An diese Zeit erinnere ich mich gern – auch an die Feste mit den Nachbarn, für uns Kinder war das toll.
«Mir kam das inszeniert vor»
Im Sommer 1989 war ich 17. Ich ging noch zur Schule, es war das letzte Jahr vor dem Abitur. In diesem Sommer hörten wir von den vielen Flüchtlingen in Ungarn und der damaligen Tschechoslowakei.
Wie genau ich davon erfuhr, weiss ich nicht mehr. Wir guckten zu Hause kein Westfernsehen. Mein Vater war bei der Armee und damit automatisch auch Mitglied der SED, deshalb gab es das bei uns eigentlich nicht. Klar, in der Schule unter den Klassenkameraden sprachen wir über alles. An viele Bilder erinnere ich mich deutlich. Ich weiss noch, dass mich einige auch verwirrt haben. Da laufen plötzlich 200 Menschen im ungarischen Niemandsland durch ein Loch im Zaun und zufällig ist eine Kamera dabei? Mir kam das inszeniert vor.
Schon Mitte der 80er Jahre – lange vor dem Mauerfall - wurde in der Sowjetunion ja ein Reformprozess in Gang gesetzt. Zwar galt der Slogan ‹Von der Sowjetunion lernen, heisst siegen lernen›, aber von Glasnost und Perestroika im eigenen Land wollte die DDR-Führung nicht so viel wissen. So wurde zum Beispiel der «Sputnik» verboten (ein Digest der sowjetischen Presse, das von der Nachrichtenagentur Nowosti herausgegeben und im Ausland vertrieben wurde – Anm. der Red.). Und das war ja alles andere als Hetzpropaganda. Das Magazin berichtete lediglich, was in Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft im Bruderstaat Sowjetunion passierte.
Die «Gorbi, Gorbi»-Rufe
Dass sich dann innerhalb so kurzer Zeit doch so viel verändern würde, hätte ich im Herbst 1989 nicht gedacht. Ich war im Oktober 1989 noch bei den Feiern zum 40. Geburtstag der DDR in Berlin dabei. Am Vorabend gab es dort einen grossen Fackelumzug. Alles war streng durchorganisiert: der Treffpunkt, die Route, die Transparente, die Parolen. Der Zug führte schliesslich an der Tribüne vorbei, auf der neben Erich Honecker und den anderen grossen Herren der DDR auch Michail Gorbatschow stand. Und ich weiss noch, dass an diesem Abend eben nicht wie üblich Erich Honecker zugejubelt wurde, sondern dass «Gorbi, Gorbi» gerufen wurde. Es war eigentlich allen klar, dass etwas passieren musste.
Es folgten der Rücktritt Erich Honeckers, weitere Demonstrationen und Kundgebungen: Man spürte deutlich, dass sich in diesen Wochen etwas veränderte im Land.
Wie ich den Tag des Mauerfalls erlebt habe, kann ich nicht mehr ganz genau rekonstruieren. Ich denke, wir haben davon in den Abendnachrichten gehört. Ich kann mich zumindest noch an diese denkwürdige Pressekonferenz erinnern, in der Günter Schabowski die neuen Reiseregelungen verkündete. Wie er auf Rückfrage eines Journalisten hin hilflos in seinen Blättern kramte und mit seinem Versprecher ungewollt die Mauer öffnete.
Vielleicht habe ich die Bilder aber auch erst später gesehen – vieles vermengt sich im Rückblick. Verstanden, was das nun genau heisst, habe ich an dem Abend aber sicher nicht. Das war definitiv erst am nächsten Tag, als die Menschen auf der Mauer tanzten.
«Ich kannte nur dieses System»
Ich war in der DDR aufgewachsen und dieser Staat und die Grenzen waren in ihrer Form so da, seit ich auf der Welt war. Ich kannte nur dieses System mit dem Eisernen Vorhang und für mich war es einfach so, dass wir nur nach Osten reisen konnten. Mich hat das bis dahin nicht gestört. Ich hatte damals auch nie den Drang, mehr von der Welt sehen zu müssen.
So hatte ich auch nicht unmittelbar nach dem Mauerfall das Bedürfnis, mir drüben alles anschauen zu müssen. Am Ende überwog aber natürlich die Neugier. Ich habe mir sechs Tage später, am 15. November, ein Visum bei der örtlichen Polizei geholt. Wir hatten alle zwei Wochen ein Unterrichtsfach, das nannte sich Wissenschaftlich-praktische Arbeit (WPA). Da gingen die Schüler für ein paar Stunden am Tag mit in die Betriebe und arbeiteten dort.
Ich war im Elektro-Apparate-Werk in Berlin in der Abteilung für Umweltschutz eingeteilt. Das EAW kennt wahrscheinlich jeder ehemalige DDR-Bürger, weil dort auch Kassettenrekorder hergestellt wurden, die in fast jedem Haushalt standen: KR-650 oder SKR-700. Das Werk war in Treptow, gleich an der Grenze. Und nach einem solchen Tag dort ging ich nachmittags nach Westberlin.
Ich ging damals vor allem, um mich umzuschauen und um mir die 100 D-Mark Begrüssungsgeld nicht entgehen zu lassen. Für jemanden, der wie ich keine Westverwandtschaft und damit keine Möglichkeit hatte, an Westgeld zu kommen, war das eine stattliche Summe.
Wie ich es drüben fand? Wir wussten ja in der DDR, dass der Westen bunter war. Aber überrollt hat mich das trotzdem: die vielen Leuchtreklamen, die riesige Auswahl. Dass es eben nicht nur zwei Sorten Butter oder Joghurt gab, sondern zehn oder 20 – und preiswerte Elektronik. Als ich genug gesehen hatte, fuhr ich abends mit der S-Bahn wieder nach Hause.
Hoffnung auf Reformen
Von den Monaten nach dem Mauerfall ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass es durchaus die Hoffnung gab, die DDR zu reformieren. Wir waren im Januar in den Winterferien und – angelehnt an den Runden Tisch in Berlin – fanden sich die Erwachsenen dort abends zu einem «Eckigen Tisch» zusammen. An dem wurde dann ganz offen diskutiert, wie es weitergehen könnte mit dem Land. Das hätte es ein paar Monate vorher nie gegeben.
An diese ersten Monate 1990 habe ich eine gute Erinnerung. Mir hat gefallen, dass man darüber diskutierte, wie man die DDR demokratisieren könnte.
All diese Überlegungen waren aber mit den Wahlen im März hinfällig, als die CDU haushoch gewann, weil sie den Beitritt zur Bundesrepublik versprach. Hätte ich mir gewünscht, dass es anders gekommen wäre? Damals schon. Zumindest konnte ich mir nicht vorstellen, dass es die DDR nicht mehr geben würde. Ich habe damals gehofft, dass sich das sozialistische System reformieren lassen würde. Aber so kam es ja nicht.
Der letzte Dienst für die DDR
Ich habe der DDR dann aber quasi einen letzten Dienst erwiesen. Ich wurde im September 1990 in die Nationale Volksarmee eingezogen – also einen Monat vor dem Ende der DDR. Wir hatten vier Wochen Grundausbildung in der NVA-Uniform. Und dann waren wir mit dem Tag des Beitritts am 3. Oktober von einem Tag auf den anderen plötzlich in der Bundeswehr – in derselben Kaserne, mit demselben Zugführer und demselben Hauptmann, nur halt in der anderen Uniform. Aber weiterhin mit russischer Kalaschnikow!
Es gab einen Appell, der Hauptmann verkündete, wir seien nun in einer neuen Armee. Und weil damals die DDR-Grundausbildung nicht anerkannt wurde, fingen wir mit allem wieder von vorne an. Ziemlich grotesk. Aber andererseits: Wer kann schon von sich kann sagen, er habe in zwei Armeen gedient?
In die Schweiz hat es mich 2001 verschlagen. Ich hatte nach dem Studium in Magdeburg zunächst in Westdeutschland gearbeitet. Über einen damaligen Arbeitskollegen knüpfte ich einen Kontakt in die Schweiz zu einer Firma, die Webseiten programmierte, zum Beispiel für Kantone und Städte. Es war nicht so, dass ich unbedingt ins Ausland wollte. Aber irgendwie dachte ich mir: Wann, wenn nicht jetzt? Ich war ja ungebunden. Damals war das mehr ein kleines Abenteuer und ich hätte nicht gedacht, dass ich hier Wurzeln schlagen würde.
Fühle ich mich noch ostdeutsch? Ich habe sicher nicht vergessen, wo ich herkomme. Was ich abgelegt habe, ist mein Berliner Dialekt – das ist vermutlich etwas, was mich von den Schweizern unterscheidet. Hier lebt ja jeder seine Mundart. Meiner alten Heimat fühle ich mich noch immer verbunden, auch wenn ich nur noch etwa einmal im Jahr dort bin, um meine Familie zu sehen. Ich kann mir heute nur irgendwie nicht mehr vorstellen, in meinem alten Heimatort zu leben.
Ich höre fast jeden Tag Fritz (ein Radiosender des Rundfunkds Berlin-Brandenburg) – das gibt mir immer ein wenig das Gefühl der Nähe. Manchmal überkommt es mich und dann krame ich auf Deezer oder Youtube nach Musik aus der DDR oder nach alten Dokumentationen. Aber ich lebe vor allem im Jetzt und Heute. Hier in der Schweiz fühle ich mich inzwischen zuhause.
«Dafür bin ich dankbar»
Auch wenn ich seinerzeit skeptisch war und mir eine Zukunft für die DDR wünschte: Im Nachhinein sehe ich die Wende als sehr, sehr grosses Geschenk der Geschichte. Es war das Beste, was mir passieren konnte. Mir persönlich hat sie viele neue Möglichkeiten eröffnet – zum Beispiel, dass ich heute in der Schweiz leben kann. Und dafür bin ich dankbar.