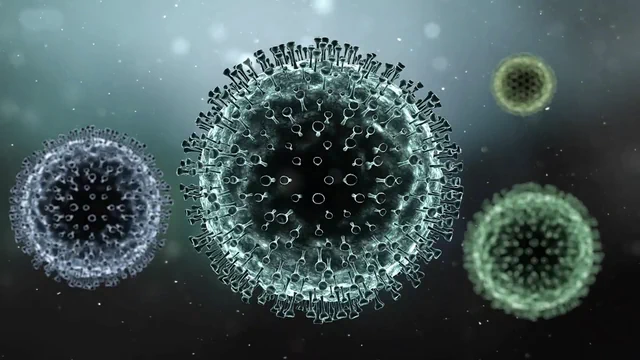Als ob das normale Coronavirus nicht schon reichen würde: Seit Dezember zirkuliert in der Schweiz auch eine mutierte Version, die Grossbritannien zur Weihnachtszeit einen steilen Anstieg der Infektionszahlen bescherte, das Gesundheitswesen schlagartig überlastete und die Insel schliesslich in einen erneuten Shutdown trieb.
Verschärfte Massnahmen gelten seit Montag auch hierzulande. Mit Ladenschliessungen und Kontaktbeschränkungen will man der neuen Situation Herr werden und die neue Virusvariante frühzeitig bremsen.
«Die Mutation hat dazu geführt, dass sich das Coronavirus besser an die Zelle binden kann», erklärt Virologe Volker Thiel, was das neue Virus derart ansteckender macht.
Wie kam es zu dieser Veränderung?
Egal, ob Corona-, Grippe- oder andere Arten von Viren: Für Mutationen müssen sie erst einmal in eine Körperzelle gelangen. Denn nur hier können sie sich vermehren.
Die gekaperten menschlichen Zellen missbrauchen die Viren dann, um immer neue Kopien von sich anzufertigen. Bei der Vervielfältigung der Erbinformation kommt es aber auch immer wieder zu Fehlern, also Mutationen.
So kann nach und nach eine Vielzahl von Virusvarianten oder Viruslinien entstehen, unter denen auch solche sein können, die dem Virus bei seinem Bestreben nach Vervielfältigung entscheidende Vorteile verschaffen können.
Den Mutationen des Coronavirus ist der Biophysiker Richard Neher seit Beginn der Pandemie auf der Spur.
Mit einer Art «Reisekarte» verfolgt und dokumentiert er alle Veränderungen. Der Stammbaum von Sars-CoV 2 zeigte schon im letzten Frühling einige Mutationen. Doch was ist jetzt anders?
«Wir haben immer erwartet, dass das Virus mutiert, und es hat es auch für viele Monate getan. Ungefähr eine Mutation alle zwei Wochen.» Jetzt gebe es aber Varianten, wo man auf einen Schlag fünf bis zehn zusätzliche Mutationen sehe.
Im Stammbaum zeigt sich dies als regelrechter Sprung. Waren es vorher acht Veränderungen, springt es fast ohne Zwischenschritt auf 38.
Um die Konsequenzen der Veränderungen zu verstehen, muss man sich die Zapfen des Virus – die Spike-Proteine – genau anschauen. Sie funktionieren wie ein Schlüssel: Trifft das Virus auf eine menschliche Zelle, muss es zuerst den Eingang finden, das Schlüsselloch sozusagen. Bei den früheren Versionen des Coronavirus dauert dies ein Weilchen und gelingt nicht immer.
Die Mutationen haben zu Änderungen an diesen Zapfen geführt. Konkret zu Veränderungen der Aminosäuren und dadurch auch der Oberfläche und Eigenschaft des Virus.
Das Virus besitzt nun ein zusätzliches Werkzeug, das mit einem Magnet verglichen werden kann. Mit diesem «magnetischen Schlüssel» findet das Virus den Eingang in die Zelle viel einfacher. Es kann schneller und effizienter an die Zelle andocken – was sich in einer 40 bis 70 Prozent höheren Ansteckungsrate ausdrückt.
Der Tippfehler im Gencode, der das Virus derart ansteckender macht, ist an der Stelle 501 zu finden. Welche Auswirkungen die dort veränderte Buchstabenfolge in der Aminosäure sonst noch hat, ist noch ungewiss.
«Es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob sich das Virus stärker vermehrt», so Volker Thiel, «und ob die Personen, die so ein Virus tragen, es auch mehr verteilen.» Es könnte aber auch sein, dass das Virus stabiler ist – was es ihm ebenfalls erleichtern würde, sich zu verbreiten.
Um Antworten zu finden, hat der Virologe mit seinem Team die neue, ansteckendere Virusvariante aus Grossbritannien nachgebaut. So können die Fähigkeiten des Virus unter Laborbedingungen untersucht werden.
Mutationen müssen ein Virus für den Menschen nicht gefährlicher machen. Es wäre auch nicht in seinem Interesse. «Ein Virus will eigentlich nur dafür sorgen, dass es Nachkommen gibt. Dass es sich in der Natur erhält und sich weiter vermehren kann», erklärt Volker Thiel.
Für den Impfstoff können die Mutationen problematisch sein. Längst bekannt ist dieser Effekt bei Grippeviren. Sie mutieren sehr stark, verändern sich mit hohem Tempo und machen so jedes Jahr einen neuen Influenza-Impfstoff nötig.
Blüht dasselbe beim Coronavirus? Volker Thiel und Richard Neher sind sich einig: im Prinzip ja, aber nicht gleich jetzt. «Wir sollten uns wohl darauf einstellen, dass der Impfstoff in Zukunft auch aktualisiert werden muss», meint Biophysiker Neher. Er rechnet damit in zwei, drei Jahren. «Aber da fehlen uns im Moment einfach die Erfahrungswerte.»