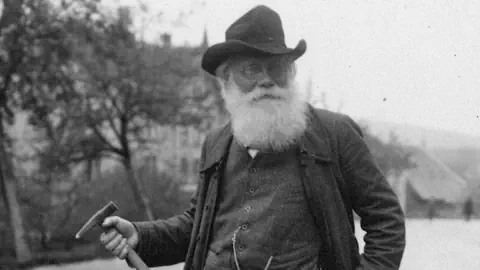Der Mineraliensammler Philippe Roth lässt es knacken. In seinem Arbeitszimmer spannt er ein unscheinbares Stück Stein in die Steinquetsche. Roth drückt den Hebelarm nach unten und eine Schneide aus Stahl sprengt den Stein in drei Teile. «Wenn wir Glück haben, bricht der Stein dort, wo wir es haben wollen. Wenn nicht, dann sind die darin enthaltenen Kristalle kaputt», schmunzelt er.
Die Mineralien, auf die es Roth abgesehen hat, sind winzig. In einem solchen Stück können sich Hunderte, wenn nicht Tausende von Kristallen verbergen. Er untersucht die Bruchstücke unter dem Mikroskop. Bei 40-facher Vergrösserung sind einige kunterbunte Strukturen zu sehen. «Nichts Spannendes», murmelt Roth und legt die Steine zur Seite.
Die Neuentdeckung aus den Glarner Alpen
Ein paar andere Stücke, die er vor einer Weile untersucht hat, waren interessanter. Die Ironie dabei: Diese Steine hatte er schon vor langer Zeit in den Glarner Alpen gesammelt. «Das Material hatte ich fast 20 Jahre lang im Keller. Erst in der Pandemie, als ich mehr Zeit hatte, habe ich das Mineral geknackt und genauer untersucht.» Dabei fielen ihm jene winzigen, giftgrünen Kristalle auf.
So sieht Heimit aus
-
Bild 1 von 5. Heimit aus dem Grossen Chalttal. Bildbreite: 1 mm. Bildquelle: Remo Zanelli.
-
Bild 2 von 5. Bildbreite: 1.3 mm. Bildquelle: Remo Zanelli.
-
Bild 3 von 5. Heimit auf Malachit. Bildbreite: 0.8 mm. Bildquelle: Remo Zanelli.
-
Bild 4 von 5. Heimit auf Chrysokoll. Bildbreite: 1.3 mm. Bildquelle: Remo Zanelli.
-
Bild 5 von 5. Bildbreite: 1.3 mm. Bildquelle: Remo Zanelli.
Als ausgebildeter Erdwissenschaftler und ambitionierter Hobby-Sammler ist Roth gut ausgerüstet. Er verfügt über ein Rasterelektronenmikroskop mit Röntgenspektroskop. Damit lässt sich die chemische Zusammensetzung eines Minerals ziemlich genau bestimmen. Er fand heraus, dass die Kristalle eine Blei-Kupfer-Arsen-Verbindung sind. Dies deutete auf ein Mineral hin, das bereits bekannt war. Aber die Form dieser Kristalle passte nicht dazu.
Philippe Roth verschickte also Proben an die ETH Lausanne und an die Universität Hamburg. Dann kam der Bescheid: Tatsächlich hat er ein neues Mineral entdeckt.
Nun galt es, die Neuentdeckung offiziell zu machen. Dafür braucht es einen Antrag bei der International Mineralogical Association, dem Dachverband der Mineralogie. Dieser gab grünes Licht für das neue Mineral. Auch für dessen Namen, den Philippe Roth vorgeschlagen hatte.
Ein neues Mineral wird getauft
«Früher hätte ich das Mineral nach meiner Grossmutter nennen können. Das geht heute nicht mehr», grinst Roth. Der Name eines Minerals muss etwas mit dessen Zusammensetzung, Fundort oder mit Geologie allgemein zu tun haben. So fiel die Wahl auf Albert Heim, einen bedeutenden Schweizer Geologen. Das neue Mineral heisst Heimit.
Wer sucht, der findet – auf der Erde und anderswo
Mineralogische Neuentdeckungen sind gar nicht so selten, wie man meinen könnte. Bis zu 200 neue Mineralien werden jedes Jahr gefunden. Das habe mit den immer besseren Methoden zu tun, so Professor Beda Hofmann, Leiter der erdwissenschaftlichen Sammlung des Naturhistorischen Museums Bern. «Die Struktur von sehr kleinen Kristallen zu bestimmen, ist eine grosse technische Herausforderung. In den letzten Jahren wurden grosse Fortschritte gemacht. Heute werden Mineralien beschrieben, die vielleicht nur 1⁄100 Millimeter gross sind.»
Mit solchen Methoden wird gesucht – und gefunden. Auf der Erde, aber auch in ausserirdischem Material, den Meteoriten, Beda Hofmanns eigentlichem Hauptforschungsgebiet. «Die meisten Mineralien aus Meteoriten findet man auch auf der Erde. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, die auf der Erde nicht vorkommen.»
Die Suche kann weitergehen. Es lohnt sich für die Sammler und Mineraloginnen immer wieder, genau hinzuschauen.