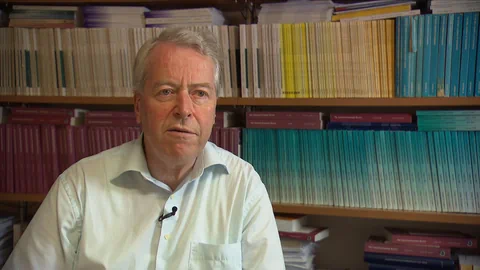Reto Lipp: Auf 100 Franken eingesetzte Bilanzsumme sollen künftig 3,50 Franken echtes Eigenkapital sein, hinzu kommen 1,50 Franken als Coco – macht das die Banken jetzt wirklich sicherer?
Aymo Brunetti: Ja, im Vergleich zur Situation zuvor mit Sicherheit. Auch das harte Eigenkapital, die 3,5 Prozent, sind eine fast 50-prozentige Erhöhung gegenüber den heutigen Anforderungen. Dazu kommen noch diese 1,5 Prozent an «High Triggered Cocos».
Diese Cocos sind aber umstritten. Man sagt, in einer Krise seien sie noch nie wirklich ausprobiert worden. Professor Hellwig, Ihr Professorenkollege, sagt, sie könnten die Krise sogar noch verstärken, wenn alle ihre Cocos loshaben wollen.
Man muss natürlich Formen von Cocos, solcher Pflicht-Wandelanleihen, unterscheiden. Diese Cocos, die hier eingesetzt werden, sind extrem hart im internationalen Vergleich. Es braucht keinen Entscheid einer Behörde, damit sie «getriggert» werden, damit sie in Eigenkapital umgewandelt werden. Es gschieht automatisch ab dem Erreichen einer gewissen Schwelle. Da gibt es dann keine Ambiguitäten, keine Unsicherheit.
Aber 5 Prozent richtiges Eigenkapital wäre besser, das würden auch Sie sagen?
Ich würde sagen, die «High Trigger Cocos» sind sehr, sehr nahe an hartem Eigenkapital.
Wir haben einen gewissen Zielkonflikt
Diese Cocos haben sich international ja nicht durchgesetzt. Sogar Credit-Susse-Präsident Urs Rohner sagt, sie sind international nicht anerkannt. Andere Länder setzen nicht auf diese Cocos. Das muss doch einen Grund haben?
Ich glaube, in der Schweiz wurde von Anfang an relativ stark darauf gesetzt. Es ist ja so, dass eben auch das harte Eigenkapital, die Nicht-Cocos, in diesen Anforderungen erhöht wird. Es ist eine Kombination von beidem, und die internationalen Vorgaben würde die Schweiz dadurch problemlos erfüllen.
Es gibt Professorenkollegen, die sagen: Man müsste eigentlich 10, 15 Prozent richtiges Eigenkapital haben, um die Banken so sicher zu machen, dass man sie nie mehr retten muss. Das heisst, auch diese neuen Vorschriften sind nicht wirklich so richtig hart.
Ich würde sagen, sie sind sehr, sehr hart im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Wir haben einen gewissen Zielkonflikt hier. – Es war ein Kompromiss. – Es ist immer ein gewisser Kompromiss, wobei wir im internationalen Vergleich jetzt sehr, sehr weit gegangen sind. Wir haben ja nicht nur die Massnahmen, wenn die Bank «lebt», die «Going Concern», wie das in der Fachsprache heisst. Wir haben zusätzlich, und das ist ein wichtiger Schritt in diesem Massnahmenpaket, noch die gleiche Summe an Kapital-Massnahmen, wenn die Bank «stirbt», also wenn sie wirklich untergeht.
Die Grossbanken waren ja auch in Ihrer Expertengruppe. Haben sie nicht dafür gesorgt, dass man das Ganze wieder ein bisschen verwässert hat – eben mit diesen Cocos: statt hartes Eigenkapital diese «komischen» Finanzinstrumente?
Sie können sicher sein: Wenn die Banken das allein hätten entscheiden können, wären ganz andere Vorgaben herausgekommen. – Also noch tiefere? – Ja, mit Sicherheit. Für die Banken sind das zusätzliche Kosten, die hier entstehen. Die Ausgangslage dieses Prozesses war: Die Schweiz ist schon besonders weit gegangen. Dass wir jetzt noch zusätzliche Massnahmen haben, zeigt doch, dass das jetzt ein harter Kompromiss ist, der hier erarbeitet wurde. Und der Kompromiss bringt immerhin, dass wir jetzt relativ schnell etwas tun können.
Es gibt Verzerrungen im Steuersystem
Die Grossbanken sagen immer: Eigenkapital ist teuer. Aber in Tat und Wahrheit ist eine Bank sicherer, wenn sie mehr Eigenkapital hat. Dadurch bekommt sie ein besseres Rating, und sie muss weniger für Fremdkapital zahlen. Sie muss also etwas mehr für Eigenkapital bezahlen und ein bisschen weniger für Fremdkapital. Eigentlich gleicht sich das doch aus?
Im Prinzip bin ich sehr einverstanden mit dieser grundsätzlichen Einschätzung. Das Problem ist, dass Eigenkapital und Fremdkapital steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Das heisst, schon rein aus steuerlichen Gründen ist Fremdkapital günstiger für die Banken. Da gibt es Verzerrungen im Steuersystem. Man könnte jetzt sagen, man müsste das korrigieren. – Das hätte man abschaffen müssen. – Sicher, aber das ist dann eine riesige Reform, die noch viel weiter geht. Und mir ist lieber, wir haben jetzt eine Reform, die die Banken relativ schnell deutlich sicherer macht als irgendeine Möglichkeit, die wir dann mal in 10 Jahren realisieren.
Es gibt Experten, die sagen, die USA haben härtere Eigenkapitalvorschriften: 5 Prozent hartes Kapital oder sogar zum Teil 6 Prozent. Stimmt das?
Nein. Sie haben im Prinzip auch eine Mischform aus diesen ganz harten und dann «Additional Tier 1», das ist etwas weniger. Es ist auch in den USA eine Mischung. Ich würde sagen, vom harten Eigenkapital her gehören wir jetzt wirklich zu den Führenden.
Weil wir ja auch einen Bankensektor haben, der viel grösser ist im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung als in den USA. Das heisst, bei uns muss man darüber hinausgehen.
In der Expertengruppe haben wir uns darauf geeinigt zu sagen: Wir wollen international zu den Führenden gehören. Dazu gehören wir mit dieser Anpassung ganz sicher, weil wir auch im «Gone Concern»-Fall noch zusätzliche Massnahmen verfügt haben.
Finanzmarktaufsicht, Nationalbank und Bundesrat haben uns das als grossen Wurf verkauft. Würde Sie sagen, das löst jetzt wirklich das Problem «Too big to fail» – wir müssen nie mehr eine Grossbank wie die UBS retten?
Es reduziert das Problem ganz gewaltig. Es ist eine Mischung aus diesen «Going-Concern»-Vorgaben. Und wir haben einen klaren Termin für den Notfallplan, was wir bis jetzt auch nicht hatten. Und wir haben noch zusätzlich dieses «Gone Concern», in dem die Schweiz ja eine Vorreiterrolle hat. Wenn wir alles zusammennehmen, hat sich die Wahrscheinlichkeit deutlich verringert.
Natürlich wissen wir nie, was passiert. Und es gibt eine «Review Clause» in diesem Gesetz. Das heisst, es wird regelmässig wieder überprüft, wenn neue Erkenntnisse kämen. Aber im Vergleich zu vorher, würde ich sagen, sind wir in einer deutlich besseren Situation.