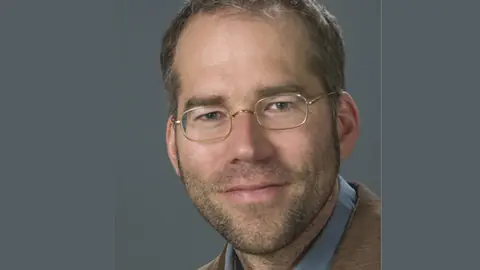-
Bild 1 von 14. Nach starken Regenfällen flutete das Hochwasser die Garage eines Gebäudes in Gachnang (TG). Bildquelle: 13.07.14, Gachnang (TG) / SRF .
-
Bild 2 von 14. Auch mehrere Fahrzeuge kamen dabei zu Schaden. Bildquelle: 13.07.14, Gachnang (TG) / SRF .
-
Bild 3 von 14. In Bern haben Feuerwehrleute vor einer Liegenschaft Sandsäcke deponiert, um sie gegen eine drohende Überschwemmung aus der Aare zu schützen. Bildquelle: 12.07.14, Matte-Marziliquartier in Bern / Keystone .
-
Bild 4 von 14. Bisher trat die Aare nicht über ihre Ufer, obwohl sie teilweise die Schadengrenze von 420 Kubikmeter Wasser pro Sekunde überstieg. Im Bild: Die Aare bei der Untertorbrücke in Bern. Bildquelle: Keystone.
-
Bild 5 von 14. Zur Sicherung vor einer Überschwemmung hat die Feuerwehr mobile Hochwasserschutzdämme montiert. An gewissen Stellen habe die Aare leicht über die Uferwege geschwappt, berichtete der Sprecher der Berner Berufsfeuerwehr, Franz Märki, am Sonntagmorgen. Bildquelle: 12.07.14, Matte-Marziliquartier in Bern / Keystone.
-
Bild 6 von 14. Immer wieder trieb Schwemmholz den Fluss hinab. Ein Kranwagen fischte das Holz heraus, damit das Wasser ungehindert abfliessen konnte. Bildquelle: srf.
-
Bild 7 von 14. In Tentlingen (FR) verwandelte sich die sonst ruhige Ärgera in kurzer Zeit zu einem reissenden Fluss, berichtet eine SRF-Augenzeugin. Die Wassermasse habe alles mitgerissen, was ihr im Weg stand, und dabei kleine wie grosse Bäume entwurzelt. Bildquelle: SRF Augenzeuge/Linda Schnarrenberger .
-
Bild 8 von 14. Nach den heftigen Regenschauern gerieten in der Gemeinde Schänis (SG) Hänge ins Rutschen. Bildquelle: 12.07.14, Schänis (SG) / Keystone .
-
Bild 9 von 14. An manchen Orten gab es kein Durchkommen mehr. Bildquelle: 12.07.14, Schänis (SG) / Keystone .
-
Bild 10 von 14. In Rickenbach (ZH) hat der Regen ganze Felder unter Wasser gesetzt. Bildquelle: 13.07.14, Rickenbach (ZH) / SRF.
-
Bild 11 von 14. Das Wasser floss nicht mehr ab. Bildquelle: 13.07.14, Rickenbach (ZH) / SRF.
-
Bild 12 von 14. Auf ins Feld mit dem Gummiboot – zwei Jugendliche nutzen das Wetter zu ihrem Vorteil. Bildquelle: SRF13.07.14, Rickenbach (ZH) / SRF.
-
Bild 13 von 14. Die Situation war noch nicht gebannt – weiter fiel Regen. 13.07.14, Rickenbach (ZH) / SRF . Bildquelle: 13.07.14, Rickenbach (ZH) / SRF.
-
Bild 14 von 14. Eine Wetterbesserung ist nächste Woche in Sicht. Bildquelle: 13.07.14, Rickenbach (ZH) / SRF.
SRF News Online: Mitte Juli gab es in der Schweiz starke Niederschläge, die in einzelnen Regionen zu Hochwasser führten. Gibt es hausgemachte Fehler, die dafür ursächlich sein können?
Volker Weitbrecht: Zunächst ist es schon so, dass in Gebieten gebaut wird, die hochwassergefährdet sind. Nach jedem Hochwasser gibt es dann immer kurzfristige Massnahmen. Weil die Hochwasser aber in relativ grossen Abständen kommen, werden Fehler trotzdem wiederholt.
Abgesehen von ungeeigneten Bauflächen, welche Fehler wurden noch gemacht?
Durch Flussbegradigungen wurden zwar Flächen nutzbar gemacht, dem Fluss aber wurde der Raum genommen auszuufern. Das Retentionsvolumen wurde gekappt. Die Folge ist eine Intensität der Hochwasserwelle.
Welche Massnahme hat der Bund ergriffen, um die Bürger zu warnen?
Für die Schweiz wurden Gefahrenkarten erstellt. Niederschläge treten teilweise willkürlich auf. Deswegen ist es wichtig, die Gefahrenbeurteilung flächendeckend abzuschliessen, um dann vorbeugende Massnahmen treffen zu können. Das Projekt hat die Schweiz jetzt abgeschlossen und nimmt damit wohl eine weltweite Vorreiterrolle ein.
Welche Schlüsse hat man aus den Gefahrenkarten gezogen?
Grossräumig werden Seeregulierungen durchgeführt. Eine Kombination aus Wettervorhersage, -prognose und die Reaktion darauf auf Seen, die man dann als Puffer verwenden kann. Das sind Lehren aus den Gefahrenkarten und vorangegangenen Unwettern.
Was passiert, wenn besiedelte Flächen in einer Gefahrenregion liegen?
Es gibt dann eine Vorgabe vom Bund an die Gemeinden, den Hochwasserschutz weiter zu entwickeln, bevor weiter gebaut wird. Es hängt aber von der jeweiligen Gefahrenstufe ab, wie verfahren wird. Im Normalfall, wird dort nicht weiter gebaut, wo Gebäude in einer gefährdeten Zone liegen oder Menschen dort wohnen.
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
In Alpnach (OW) liegen gewisse Ortsbereiche in der Gefahrenzone. Die können aus Sicht der Gemeinde nicht so weiter entwickelt werden, wie man das gerne möchte. Da muss man erst den Hochwasserschutz in den Griff bekommen.
Je nach Region sieht der Hochwasserschutz anders aus. Nach welchen Kriterien wird entschieden?
Die Frage beim Hochwasserschutz ist immer: Bis zu welchem Schutzziel geht man überhaupt? Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) spricht von einem differenzierten Hochwasserschutz. Da gibt es verschiedene Kennzahlen bis hin zum Extremfall, dem sogenannten Überlastfall.
Wo wurde ein solcher Überlastfall bereits einkalkuliert?
Beim Linthkanal wurde eine solche Lösung gefunden. Ab einer gewissen Auslastung wird dort das Wasser nicht mehr durch den Linthkanal geleitet. Das Wasser wird stattdessen gezielt ausgeleitet, um einen Dammbruch zu verhindern. Die Sanierung des Linthwerks wurde letztes Jahr fertiggestellt, weil die Dämme in die Jahre gekommen sind. Der Hochwasserschutz ist dort nun gewährleistet und der Überlastfall kalkulierbar.
Beim Überlastfall kommt es also auch zu einer Überflutung?
Im Überlastfall wird es in jedem Fall zu Schäden kommen, aber das Wasser lässt sich eventuell über landschaftliche Flächen zum Beispiel in einen See umleiten und fliesst so nicht mehr durch den Ortskern. Damit wird ein unkontrollierter Ausfall des Systems verhindert. Bei einer kontrollierten Überflutung weiss man also, wo die Schäden entstehen.
Wenn das alles bekannt ist. Wie kann es dann noch sein, dass es zu Hochwassern mit Menschen- oder Gebäudeschäden kommt?
Der Hochwasserschutz versagt, wenn Abflussszenarien herrschen, die man nicht so vorhergesehen hat. Entweder hat man sich bei der Definition eines Schutzzieles vertan oder den Überlastfall nicht einkalkuliert. Dann kann es sogar zu grösseren Schäden kommen, als wenn man dort gar keinen Hochwasserschutz vorgenommen hätte.
Gibt es weitere Gründe?
Es ist nicht garantiert, dass ausgearbeitete Pläne zum Hochwasserschutz auch so umgesetzt werden können. Da gibt es viele Interessengruppen. Bei neueren Projekten hat man das sehr gut gemacht. So beispielsweise bei der Sanierung des Linthwerks. Dort hat man alle Interessengruppen von Beginn an eingebunden. Aber generell dauert Planung und Umsetzung lang. Rein technisch kann man alles schützen, aber die Frage ist: Kann man das bezahlen? Was kostet die Wartung? Hat man die Ressourcen dafür? Ingenieurtechnische Lösungen hat man aber eigentlich relativ schnell zur Hand.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel beim Hochwasserschutz in Zürich: Ein Problem ist das Schwemmholz. Man möchte das Schwemmholz oberhalb von Zürich zurückhalten, um einen Wasser-Rückstau am Bahnhof zu verhindern. Wir haben dazu einen Schwemmholzrechen entwickelt, der 2016 einsatzfähig ist. Vom Hochwasser 2005 bis 2006 sind also 11 Jahre vergangen – das ist noch überschaubar. Für das grosse Hochwasser braucht man aber zusätzliche Massnahmen.
Haben denn die Niederschläge zugenommen?
Niederschlagsaufzeichnungen hat man erst seit 70 bis 100 Jahren. Trotzdem lässt sich anhand der Aufzeichnungen eine Erhöhung von extremen Abflussereignissen in den letzten zwanzig Jahren feststellen.
Wird es irgendwann einmal den hundertprozentigen Hochwasserschutz geben?
Den vollständigen Schutz wird es nie geben. Es wird immer Ereignisse geben, die in ihrer Intensität unvorhersehbar sind.